| A.usgesperrt (оригинал) | A.usgesperrt (перевод) |
|---|---|
| Draußen vor’m Schneckenhaus | За пределами раковины улитки |
| kniet in der Erde, nass und kalt, | стоит на коленях в земле, мокрая и холодная, |
| ein Kind mit Augen gar so braun | ребенок с глазами даже такими карими |
| wie Kandis und | как конфеты и |
| wie gebrannte Mandeln. | как жареный миндаль. |
| Sie hat ihr Köpfchen | У нее есть мозги |
| in ihre Hände gelegt | положили в их руки |
| und hofft, dass sie | и надеется на тебя |
| endlich ein Mondenstrahl | наконец-то лунный луч |
| federleicht weit davon trägt. | легкий как перышко далеко. |
| Neben dem Schneckenhaus | Рядом с раковиной улитки |
| liegt keuchend, blutend im Staub, | лежит задыхаясь, истекая кровью в пыли, |
| von all dem Geschrei | от всех криков |
| noch ganz taub, | еще совсем глухой |
| eine Gestalt: ja, es ist der Junge. | фигура: да, это мальчик. |
| Bleich wie der Nebel am See, | Бледный, как туман у озера, |
| wie ein weißes Kaninchen | как белый кролик |
| im Schee, | в снегу |
| haucht er mit letzter Kraft: | он дышит из последних сил: |
| «Wir schaffen es zusammen.» | «Мы можем сделать это вместе». |
| Dort vor dem Scheckenhaus | Там перед домом шашки |
| hält man sich eng aneinander fest, | крепко держать друг друга |
| fern vom Rest der Welt, | далеко от остального мира |
| die nur die Flucht in die Wolken zulässt. | что позволяет летать только в облаках. |
| So wie ein Märchenbuch, | Как книга сказок |
| wie der Besuch | нравится визит |
| von einem bösen Traum, | из дурного сна |
| endet die Unschuld stets | невинность всегда заканчивается |
| am Ende der Geschichte. | в конце рассказа. |
| Wir haben viel gesehen | мы видели много |
| und noch viel mehr gefühlt, | и многое другое чувствуется |
| uns mit Händen und mit Füßen | мы руками и ногами |
| durch die Erde | сквозь землю |
| der Vergangenheit gewühlt, | уходит корнями в прошлое |
| wir haben nicht begriffen | мы не поняли |
| und auch nicht verstanden, | и тоже не понял |
| dass die Geister, die wir riefen, | что духи, которых мы назвали |
| einen neuen Körper fanden, | нашел новое тело |
| in dem sie sich niederließen, | в котором они поселились |
| den sie wie ein Bild verzerrten, | которую исказили, как картинку, |
| während wir uns wie die Narren | пока мы ведем себя как дураки |
| aus dem Schneckenhaus aussperrten. | заперт из раковины улитки. |
| Wir sind an uns selbst gescheitert, | Мы потерпели неудачу сами |
| an Dämonen, die erschienen, | появившихся демонов |
| trotzdem spendet dieses Opfer | тем не менее эта жертва дарит |
| mehr Trost als wir je verdienen. | больше комфорта, чем мы когда-либо заслуживали. |
| Aus deinen treuen Augen | От твоих верных глаз |
| starrt mich uns’re Torheit an, | наша глупость смотрит на меня, |
| ich ertrage nicht, dass man uns | я терпеть не могу этого нас |
| so viel Schuld abnehmen kann; | столько чувства вины может уменьшиться; |
| für die Umkehr gäbe ich | Я бы дал за возвращение |
| Gott ohne Zögern meine Hände, | Боже без колебаний руки мои, |
| dann bestimmte ich und nicht du | тогда я решаю, а не ты |
| über der Erzählung Ende. | о конце истории. |
| Dann wär ich zur rechten Zeit | Тогда я был бы в нужное время |
| am rechten Ort ich selbst gewesen, | был сам в нужном месте, |
| anstatt wie gelähmt nur mir selbst | вместо того, чтобы просто меня парализовало |
| uns’re Zukunft vorzulesen | читать наше будущее |
| und von ihr das, was ich selbst nicht konnte | и от нее то, что я не мог сделать сам |
| feige zu verlangen: | трусливо требовать: |
| einmal mehr wurde | снова стал |
| ein größter Fehler | самая большая ошибка |
| rücksichtslos begangen. | совершил необдуманно. |
| Wir war’n Mörder und wir haben | Мы были убийцей, и мы |
| uns wie Diebe einander vergiftet, | травили друг друга, как воры, |
| einem Schiff gleich, das vom Kurs | как корабль, сбившийся с курса |
| der Wahrheit immer weiter abdriftet, | правда продолжает отдаляться |
| und unaufhaltsam, einsam, | и неудержимый, одинокий, |
| seinem Ende still entgegentreibt. | молча до конца. |
| Die Zeit heilt alle Wunden | Время лечит |
| doch die Kerbe im Mast bleibt. | но выемка в мачте осталась. |
| Wieso sind wir noch am Leben, | Почему мы все еще живы |
| wenn uns nichts und niemand stützt, | когда ничто и никто нас не поддерживает, |
| weil uns eine Katze mehr als alle | потому что мы кот больше всех |
| Menschen auf der Welt beschützt? | защитить людей в мире? |
| Wenn ich mich zu dir lege | Когда я ложусь с тобой |
| und in deine treuen Augen seh, | и посмотри в твои верные глаза, |
| dann tut mir dieses Ende | то это конец мне |
| mehr als alle and’ren Enden weh. | больнее, чем все остальные концы. |
| Fürchtet euch nicht, | не бойся |
| denn ich hab keine Angst, | потому что я не боюсь |
| so ruf ich nach den Krähen: | поэтому я призываю ворон: |
| Tragt mich davon! | унеси меня |
| Unsere Zeit nimmt dem Ende den Sinn, | Наше время имеет смысл конца |
| weil ich in euren Herzen | потому что я в ваших сердцах |
| unsterblich bin. | я бессмертен. |
| Am Ende der Geschichte | В конце рассказа |
| blicke ich in ein Gesicht, | я смотрю в лицо |
| aus dem die hoffnungsvolle Stimme | откуда доносится обнадеживающий голос |
| meiner Liebe aller Leben spricht. | моя любовь ко всем жизням говорит. |
| Am Ende der Geschichte | В конце рассказа |
| lässt uns unser Engel leise | наш ангел оставляет нас в покое |
| mit uns selbst allein und setzt sie fort, | наедине с собой и продолжается |
| seine lange Reise. | его долгое путешествие. |
| Ich wünsche mir, dass er erneut | Я хочу, чтобы он снова |
| zwei Menschen, wie uns beide, findet, | находит двух таких же, как мы оба, |
| die er dann durch seine Kraft | что он тогда своей силой |
| so fest wie uns zusammenbindet, | так крепко, как связывает нас вместе, |
| um sie am Fuße eines Berges | вокруг них у подножия горы |
| auf den Weg zu schicken, | отправить в путь |
| damit sie eines Tages auf das Tal | так что однажды они достигнут долины |
| zu ihren Füßen blicken. | посмотрите на их ноги. |
| Am Tag, als du geboren warst, | День, когда вы родились |
| sangen alle Meere, | все моря пели |
| der Wind blies dir zur Ehre | ветер дул в твою честь |
| die Wellen an das Land. | волны на суше. |
| Ich schreibe uns’re Namen | Я пишу наши имена |
| in den Sand, | в песке |
| damit das Wasser uns vermischt. | чтобы вода смешала нас. |
| Durch dich allein flogen wir | Только через тебя мы летели |
| lebend und verwandelt | живой и преображенный |
| aus dem Licht. | вне света. |
Перевод текста песни A.usgesperrt - Samsas Traum
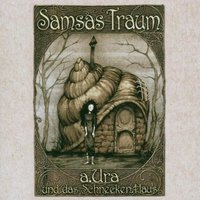
Информация о песне На данной странице вы можете ознакомиться с текстом песни A.usgesperrt , исполнителя -Samsas Traum
Песня из альбома: a.Ura und das Schnecken.Haus
В жанре:Иностранный рок
Дата выпуска:12.03.2009
Язык песни:Немецкий
Лейбл звукозаписи:Trisol
Выберите на какой язык перевести:
Напишите что вы думаете о тексте песни!
Другие песни исполнителя:
| Название | Год |
|---|---|
| 2009 | |
| 2009 | |
| 2009 | |
| 2009 | |
| 2009 | |
| 2012 | |
| 2009 | |
| 2009 | |
| 2015 | |
| 2024 | |
| 2009 | |
| 2009 | |
| 2009 | |
| 2015 | |
| 2009 | |
| 2009 | |
| 2009 | |
| 2015 | |
| 2009 | |
| 2009 |